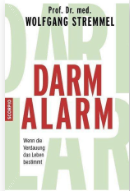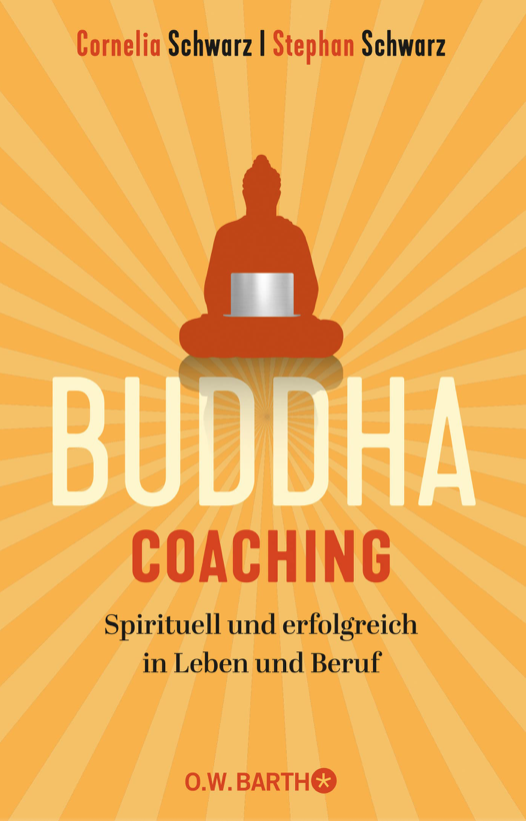Es war sehr spannend, mit einem zweifachen Vize-Europameister im Karate zu arbeiten – und ich bin nicht k.o gegangen, sondern habe viel Interessantes erfahren über mentale Fitness als Basis körperlicher Leistungskraft, Gesundheit und Lebensfreude.
Wie geht es Ihnen?
… Vermutlich suchen Sie gerade nach Antworten, Lösungen. Am einfachsten wäre es, aus diesem Buch würde ein Wunder fallen, eine Art Geheimcode. Den würden Sie sich auf die Stirn oder ins Herz tippen und alles wäre perfekt und dann: weiter so.
Mit dieser kuriosen Idee kommen manche meiner Klienten zu mir. Angenommen es wäre so. Angenommen es gäbe diesen Code. Was dann? Weiter so wie immer und immer weiter? Ist das wirklich das ganze große schöne wilde bunte pralle Leben? Weiter so wie gehabt?
Auf den folgenden Seiten stelle ich Ihnen einen anderen Weg vor. Ich glaube, dass Sie reif für diesen Plan sind. Irgendwie ist dieses Buch zu Ihnen gekommen, so wie es auch zu mir gekommen ist. Ich habe viele Jahre, Jahrzehnte darauf zu gelebt. Es hat gedauert, bis sich die Essenz herausdestilliert hatte, und ich bin zahlreiche Umwege gegangen, für die ich heute dankbar bin. „Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden“, notierte der Philosoph Sören Kierkegaard. Die Fährten, die wir morgen und übermorgen lesen, legen wir heute. Wohin werden sie uns führen?
Vielleicht ist dies der Augenblick, in dem Sie eine andere Richtung einschlagen. Weil Sie spüren, dass es jetzt höchste Zeit ist. Weil Sie genug haben von all dem Bekannten. Weil Sie nicht mehr so weitermachen können oder wollen wie bisher. Weil Sie Lust auf etwas Neues haben. Es muss ja nicht sein, dass Sie sich so fühlen, wie eine Klientin es neulich beschrieb:
„Ich komme mir vor wie eine Zitrone. Total ausgequetscht, ausgelaugt, empty. Ich habe keinen Saft mehr.“ Dann erzählte sie mir, woran das lag: Extrem stressiger Job, hohe Verantwortung, alleinerziehend.
„Wie kann ich dich unterstützen?“, fragte ich. Denn ich konnte ihr ja weder im Job noch mit ihren Kindern helfen.
„Ich brauche vermutlich ein besseres Zeitmanagement“, antwortete sie.
Das glauben viele meiner Klienten. Auch diejenigen, die etwas für ihre Gesundheit tun wollen oder müssen. Immer ist die Zeit schuld, die man nicht hat. Als würde einem die irgendwer wegnehmen. Wer das wohl ist?
Vor meiner Klientin und mir stand ein kleiner Tisch, darauf eine Karaffe Wasser und zwei Gläser. Ich nahm die Karaffe und begann, ein Glas zu füllen. Leicht irritiert beobachtete mich meine Klientin. Goss ich für sie ein? Ich hatte sie nicht gefragt, ob sie trinken wollte. Oder füllte ich ein Glas für mich? Ich goss weiter. Gleich würde das Wasser überlaufen.
„Stopp!“, sagte sie laut
Ich schüttete weiter.
Jetzt riss sie die Augen auf. War ich übergeschnappt?
„Das Glas ist doch schon längst voll!“, rief sie.
„Genau“, sagte ich.
„Aber …“, begann sie. Mit Aber beginnen viele Sätze meiner Klienten, zumindest anfangs. Später wird das Aber seltener. Wenn man merkt, dass Veränderung möglich ist, braucht man diese Bestätigung, in der Komfortzone bleiben zu dürfen, nicht mehr so oft. Meine Klientin war eine kluge Frau. Sie hatte es sehr schnell verstanden. „Oooookaaaayyyy“, sagte sie langgedehnt. „Du meinst also, dass mein Glas schon längst viel zu voll ist. Dass da gar nichts mehr reinpasst.“
Ich nickte.
Da machte sie etwas, womit sie mich überraschte. Sie nahm das Glas, das in einer Lache auf dem Tisch stand und schüttete den Inhalt in die Palme hinter sich. Dann lachte sie. Auf einmal sah sie ganz anders aus. Ihre zuvor angestrengten Züge glätteten sich. Ihr Körper entspannte sich. Befreit wirkte sie. ich lachte mit und dachte, wie gut, dass die Palme hinter ihr steht. Aber es wäre auch Oooookaaaayyyy für mich gewesen, wenn sie das Wasser auf den Boden gekippt hätte. Kann man wegwischen.
„Jetzt ist wieder Platz“, sagte meine Klientin. „Jetzt können wir anfangen.“
Vom Wissen ins Tun
Ready for Reset ist eine Abkürzung, für die ich die wirkungsvollsten Methoden basierend auf westlichem und östlichem Wissen zusammengefasst habe. Dennoch ist es kein Quick-fix. Veränderung braucht Zeit. Aber nicht unbedingt Jahre und nicht zwingend, indem man zuerst große Krisen durchleidet, um etwas wirklich zu verändern. Alles ist ja schon da. Wie bei einem Schokoladenkuchen, den wir backen wollen. Wir haben die Zutaten eingekauft, wir kommen auf die Welt mit allen Möglichkeiten. Doch wir brauchen Techniken, um die Herausforderung Leben als Schokoladenkuchen aufgehen zu lassen. Es nutzt nichts, wenn man alle Zutaten parat hat. Mehl und Eier und Schokolade und Milch. Man muss wissen, wie viel wovon in welcher Reihenfolge hinzuzugeben ist, bei welcher Temperatur der Teig gedeihen soll, damit der Kuchen gelingt und nicht im Herd explodiert, zusammenfällt oder über die Form quillt.
Vielen meiner Klienten wäre eine Veränderungspille am liebsten. Einmal schlucken, und alles ist anders. Gerade Führungskräfte haben wenig Zeit – und randvolle Gläser. Früher haben sie ihre Terminkalender gezückt und ein freies Plätzchen für unser nächstes Date gesucht. Und keines gefunden. Heute wischen sie auf ihren Smartphones herum. „Am besten, Sie schreiben jeden Morgen eine Stunde Ihren eigenen Namen hinein“, sage ich manchmal. Das finden sie zuerst nicht lustig. Nicht wenige tun das aber nach einer Weile freiwillig. Und gern. Weil sie gemerkt haben, wie viel sich verändert, wenn man sich selbst so wichtig nimmt wie all das andere Zeug außen herum. Und wenn man den Füllstand seines Glases im Blick behält.
Wir können nichts verlieren, nur gewinnen: uns selbst! Im Glas des Lebens ist dann immer genug Platz für all die schönen Dinge, die geschehen können. Für Informationen, die einen wirklich interessieren. Für Begegnungen mit Menschen, die einen inspirieren oder einfach nur das Herz wärmen. Wenn das Wasser im Glas sanft schwappt wie ein See, dann ist unser Leben in Fluss.
In meinen Anfangsjahren als Coach glaubte ich, dass es vor allem auf ein perfektes Zeitmanagement ankäme. Dann wären, wenn auch nicht alle, so doch viele Probleme gelöst. Also strukturierte ich die Tage meiner Klienten neu und unterbreitete ihnen Vorschläge für ihre Work-Life-Balance. Manchmal war ich frustriert, weil so gut wie keine meiner tollen Ideen sich langfristig durchsetzte. Sie verloren gegen eingefahrene Gewohnheiten, gegen die Komfortzone, den inneren Schweinehund. Es kam mir so vor als würden sich manche meiner Klienten selbst sabotieren. Sie wussten, dass sie etwas verändern mussten, sie buchten einen Coach und beruhigten damit ihr Gewissen oder kauften sich sozusagen einen Freifahrtschein, damit alles so bleiben konnte wie zuvor.
… Kann es ja auch. Wenn es gut läuft. Aber wenn nicht oder wenn ein ungesunder Lebensstil die Gesundheit gefährdet, dann … ist es Zeit für einen Reset! Und der hat nichts mit dem Alter zu tun! Den Reset brauchen erschreckenderweise auch immer mehr junge Menschen.
Als Dozent an der Hochschule in Sankt Gallen arbeite ich viel mit jungen Menschen und bin regelrecht erschüttert, wie erschöpft viele von ihnen sind. Menschen, die dauerhaft Stress ausgesetzt sind, haben nicht mehr alle ihre Ressourcen zur Verfügung. Und so finden sie keine Lösungen für ihre Nöte:
Ich hetze von morgens bis abends durch den Tag.
Ich spüre oft großen Druck.
Bin irgendwie total orientierungslos.
Zu viel Arbeit auf dem Tisch.
Mein Privatleben existiert nicht mehr
Ich weiß gar nicht mehr, was wirklich wichtig ist, was ich eigentlich will.
Bin schnell überfordert, gereizt und ungeduldig.
Mir ist alles zu viel.
Die Zukunft macht mir Angst.
Mein Pflichtbewusstsein versaut mir das Leben.
Ich kann nicht Nein sagen.
Habe große Schwierigkeiten, Entscheidungen zu fällen.
Ich funktioniere nur noch, meine Kreativität ist auf der Strecke geblieben.
Das Leben hat Farbe verloren, ist grau geworden.
Wenn wir uns ständig mit unseren Ängsten und Sorgen befassen, wenn wir fragen: Warum kann ich dies und jenes nicht … dann schrauben wir uns immer tiefer hinein. Das ist unglaublich anstrengend und zermürbend! Doch wenn man gewohnt ist, es so zu machen, dann macht man es eben so. Man gräbt im Problem nach einer Lösung, manchmal jahrelang. Da muss sie doch irgendwo sein. Nein, da ist die Lösung genau nicht. Das wusste auch Albert Einstein, der eine neue Dimension entdeckt hat: „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
Fatal ist es, wenn wir selbst gar nicht merken, dass wir in der Problemschleife hängen. Nicht selten höre ich von Klienten „Sorgen habe ich eigentlich keine“. Wenn wir dann aber die Software im Hintergrund checken, kommt doch so einiges zu Tage. Vieles ist uns eben nicht bewusst.
Und das soll sich ändern!